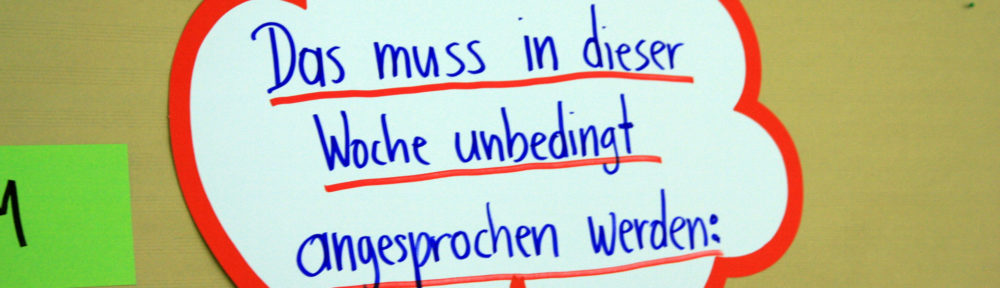Deutsche Post Der Streik wird zur Machtprobe zwischen dem Konzern und Verdi: Lässt sich Lohndumping hierzulande überhaupt noch verhindern?
Von Jörn Boewe und Johannes Schulten, der Freitag, 18. Juni 2015
Zumindest seine Ehrlichkeit muss man dem Post-Vorstand Jürgen Gerdes hoch anrechnen: Zwar sei es ungerecht, wenn Unternehmen unterschiedliche Löhne für gleiche Arbeit zahlen, meinte der Manager. „Sie werden aber kein Unternehmen finden, bei dem es anders ist.“ Für alle, die es immer noch nicht verstanden haben: Die Unternehmer haben sich zwar jahrelang Hand in Hand mit dem DGB für ein Tarifeinheitsgesetz stark gemacht. Tatsächlich ist ihnen das Prinzip „Ein Betrieb – ein Tarifvertrag“ aber vollkommen egal.
Derzeit vollzieht die Post das mit ihren Paketzustellern. 6.000 der 24.000 befristet Beschäftigten wurden bereits in diesem Jahr in 49 eigens gegründete Billiglohntöchter überführt. Zehn- bis zwanzigtausend sollen es bis 2020 werden. Bezahlt werden sie nicht mehr nach dem Haustarifvertrag der Post, sondern auf dem Niveau der Speditionsbranche. Nach Gewerkschaftsangaben liegen hier die Löhne bis zu 20 Prozent niedriger.
Anfang Juni hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi alle DHL-Beschäftigten zu unbefristeten Streiks aufgerufen. Für die Gewerkschaft ist es eine erbitterte Verteidigungsschlacht: Bei Verdi sind rund 80 Prozent der 140.000 Post-Angestellten organisiert. Das ist ein Anteil, wie man ihn in den Großbetrieben der Metall- und Chemieindustrie kennt, aber nicht im Dienstleistungssektor. Wenn es Verdi irgendwo gelingen kann, den Outsourcing-Strategien Grenzen zu setzen, dann bei der Post.
Dieses dichte Netz gewerkschaftlicher Organisation ist ein Erbstück der alten Bundespost. In den Jahren des Nachkriegsbooms hinkten die Gehälter der Postangestellten denen der Industriearbeiter immer deutlich hinterher. Gewerkschaftliche Selbsthilfeorganisationen gewannen deshalb stark an Bedeutung. Davon zehrt Verdi heute noch. Dass die Postler in der Lage sind, einen entschlossenen Arbeitskampf zu führen, bewiesen sie zuletzt 2008, als der Konzern versuchte, die Arbeitszeit auf 41 Wochenstunden zu verlängern. Mit einem 30-tägigen Streik konnten die Beschäftigten die Pläne durchkreuzen.
Einstieg in den Abstieg
Der aktuelle Konflikt erinnert an den sechswöchigen Telekom-Streik 2007. Die ehemalige Post-Tochter hatte damals – nicht lange nach dem Einstieg des Finanzinvestors Blackstone – 50.000 ihrer Beschäftigten in die Billiglohntochter T-Service überführt. Wie heute bei der Post versuchte Verdi die Aufspaltung des Konzerns mit einem Streik zu verhindern. Die Telekom drohte darauf, die Servicegesellschaften komplett zu verkaufen. Die Erpressung ging auf: Obwohl der Streik Wirkung zeigte, akzeptierte Verdi zähneknirschend die Ausgliederung. Das Ergebnis: Für Altbeschäftigte wurden die Löhne um 6,5 Prozent gekürzt, für Neueingestellte um 30 Prozent. Die Streikenden waren von dem Deal wenig begeistert. Eine monatelange „organisationsinterne Aufklärungskampagne“ – so die Sprachregelung der Gewerkschaft – war nötig, um die Mitglieder zur Annahme des Kompromisses zu bewegen, der immerhin betriebsbedingte Kündigungen bis 2012 ausschloss. Resignation machte sich breit. Die Spaltung der Beschäftigten war festgeschrieben, der Einstieg in die Abwärtsspirale vollzogen.
Das Gleiche versucht heute die Post AG. Nur so könne man wettbewerbsfähig bleiben, heißt es zur Begründung. Das passt gut zum Zeitgeist, ist aber Unfug: Die Post ist Branchenführer und wettbewerbsfähiger als jeder Konkurrent. Müsste das Unternehmen tatsächlich um seine Marktposition kämpfen, wäre zu erwarten, dass es Gewinne vor allem reinvestiert. Tatsächlich wird mehr als die Hälfte des Überschusses ausgeschüttet. Erst vor drei Wochen wurde die Dividende zum wiederholten Mal erhöht.
Der Börsenstar
Überhaupt kommt in diesem Konflikt viel psychologisches Brimborium zum Einsatz: So etwa die Erzählung, die Privatisierung habe aus der verstaubten „Schneckenpost“ (Handelsblatt) einen modernen Logistikdienstleister gemacht. Wie der Historiker Bernt Engelmann in seinem Buch über das deutsche Kaiserreich schreibt, schaffte es die angeblich schlafmützige Behörde bereits vor mehr als hundert Jahren, in Großstädten wie Berlin dreimal täglich Briefe zuzustellen. Auf die Idee, die Briefzustellung montags einzustellen, kam erst der „Modernisierer“ Frank Appel im Jahr 2009.
Es ist eine Ironie der Geschichte, dass die Post als Ex-Staatskonzern hier lehrstückhaft demonstriert, was „finanzmarktgetriebener Kapitalismus“ bedeutet. Denn der Börsenstar Post ist Täter und Opfer zugleich. Ohne Not gab Vorstandschef Frank Appel 2014 eine Gewinnprognose bis 2020 aus – für einen DAX-Konzern ein völlig unüblicher Vorgang. Bis zum Ende des Jahrzehnts soll der Gewinn jährlich um acht Prozent wachsen, von 2,9 auf mindestens fünf Milliarden Euro. Fällt die Post unter diese selbst gesetzte Benchmark, wird sie den Märkten künftig als low performer gelten, mit allen Konsequenzen für Aktienkurs und Refinanzierungsmöglichkeiten. So sind die Spielregeln. Die Geister, die Appel rief, wird er nicht mehr los.
In diesem Panorama sind Tarifflucht und Lohndumping nicht nur eine vermeintlich unkomplizierte Strategie zur Kostenreduzierung, sondern auch ein wichtiges Signal an die flatterhaften Finanzmärkte. Dass die Post ihre Outsourcing-Runde ausgerechnet um den Jahreswechsel 2014/15 herum einleitete, war kein Zufall. Offenkundig wollte der Vorstand den Aktionären bereits auf der Hauptversammlung im Mai Ergebnisse präsentieren.
Dazu passt, dass das Management schon 2014 immer mal wieder bei Verdi vorstellig wurde, um über eine Absenkung der Löhne zu verhandeln. Wahrscheinlich glaubte man, die Gewerkschaft ähnlich unter Druck setzen zu können wie einen Lieferanten, der auf eine Verlängerung eines langfristigen Dienstleistungsvertrags hofft. Doch offenbar hatte die Post nicht bedacht, dass Tarifpolitik in Deutschland, jedenfalls bislang, immer noch anders funktioniert als die Geschäftsbeziehungen zwischen einem Quasi-Monopolisten und seinen abhängigen Zulieferern. Noch sind Briefzusteller und Paketboten keine Drohnen, sondern lebendige Menschen. Wer sich mit ihnen anlegt, muss auf menschliche Reaktionen gefasst sein.
Dieser Beitrag erschien in Ausgabe 25/15.