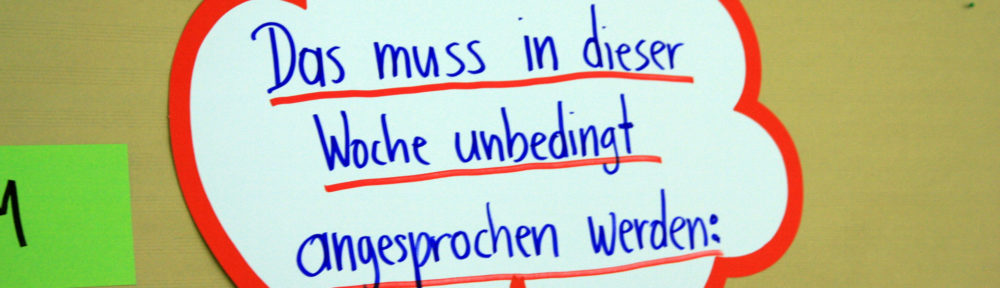Befürworter der Transatlantischen Freihandels- und Investitionspartnerschaft werfen Kritikern Panikmache vor. Doch Erfahrungen mit vergleichbaren Abkommen zeigen: Die Warnungen sind berechtigt.
Von Jörn Boewe und Johannes Schulten, Magazin Mitbestimmung 03/2014
Das Chlorhuhn bewegt. Es ist zum Wappentier der Gegner der geplanten Transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) geworden. Seit Mitte vergangenen Jahres verhandelt die EU-Kommission mit den USA über den Abschluss eines Abkommens, das Zugangsbarrieren für die jeweiligen Märkte senken, Investitionen langfristig absichern und eine Schiedsgerichtsbarkeit installieren soll, vor der Investoren ihre Ansprüche aus dem Abkommen durchsetzen können sollen. Nicht nur diese Schiedsverfahren sollen geheim ablaufen. Auch aus den laufenden Verhandlungen wurde die Öffentlichkeit bislang ausgeschlossen. Sogar Inhalte und Zielrichtung der Gespräche sowie die Zusammensetzung der Verhandlungsgruppe wurden unter Verschluss gehalten – bis es engagierten NGO-Aktivisten gelang, einige Dokumente zu „leaken“.
SKEPSIS BEIM DGB WÄCHST
Die EU-Kommission selbst hat bislang außer optimistischen Prognosen und Statements zur Beschwichtigung der öffentlichen Meinung nichts Konkretes veröffentlicht. „Die TTIP hat Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen zum Ziel“, heißt es auf ihrer Internetseite. Sie könnte „die Wirtschaft der EU um 120 Milliarden Euro“ ankurbeln und „Hunderttausende neue Arbeitsplätze kreieren“. Gelingen soll dies durch die Angleichung unterschiedlicher „Regelwerke, Normen und Zulassungsverfahren“.
Das klingt so plausibel wie harmlos nach DIN und TÜV und Blauer Engel, und fast schien es, als könne keiner etwas dagegen haben. Aber dann hielt Anfang Januar jemand das Chlorhuhn hoch: Um Salmonellen und andere Keime im Hühnchenfleisch abzutöten, dürfen US-Farmer ihr Geflügel in einer Lauge aus Chlordioxid und Natriumchlorit desinfizieren. Nach Europa dürfen die Giftcocktail-Chicken bislang nicht eingeführt werden – doch das würde sich mit der TTIP ändern. Ein Aufschrei ging durch Europa! Was die Argumente der Freihandelskritiker von Attac und NGOs nicht fertiggebracht hatten – das Chlorhuhn rüttelte die Öffentlichkeit wach.
Doch nicht nur Verbraucher- und Umweltschutzstandards kämen durch die TTIP unter Druck, befürchten die Kritiker. Auch Arbeitsschutzbestimmungen und Beschäftigtenrechte sind bedroht. Nach der Logik der Freihandelsdoktrin gelten sie letztlich als „nichttarifäre Handelsbarrieren“, die den Marktzugang erschweren oder Gewinnerwartungen schmälern können. Mitte Januar traten deshalb 60 Gewerkschafter und Intellektuelle mit einem Appell an die Öffentlichkeit, der vor einem Abbau von Arbeitnehmerrechten durch die TTIP warnte. Die Initiatoren, darunter der Publizist Werner Rügemer und der Arbeitsrechtler Wolfgang Däubler, fürchten, der Vertrag würde die Koalitionsfreiheit beschneiden und Arbeitsstandards absenken. So hätten die USA „sechs von acht Kernnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) nicht ratifiziert“, heißt es in dem Aufruf.
Ähnlich kritisch hatte sich bereits im Frühjahr vorigen Jahres der DGB geäußert. Die „Vereinheitlichung von Standards und Normen“ dürfe „nicht zulasten des Gesundheits-, Arbeits-, Verbraucher- und Umweltschutzes“ gehen, forderte der DGB. Zwar seien Wohlfahrtseffekte, die sich aus einem Handelsabkommen ergeben könnten, zu begrüßen. Gleichwohl warnte der DGB vor „übertriebenen Erwartungen“. „Wir waren damals skeptisch“, sagt Florian Moritz, Leiter des Referats Internationale und Europäische Wirtschaftspolitik beim DGB-Bundesvorstand, „und unsere Skepsis ist seitdem gewachsen.“
FRAGWÜRDIGE MODELLRECHNUNGEN
Übertrieben wird in der Tat, und zwar systematisch und mitunter erstaunlich plump. So behauptet die EU-Kommission auf ihrer Internetseite, dass „nach vollständiger Umsetzung dieses Abkommens (…) ein jährliches Wirtschaftswachstum von 0,5 Prozent BIP“ zu erwarten sei. Abgesehen davon, dass es sich bei dem „unabhängigen Bericht“, auf den sich die Kommission beruft, um eine von ihr in Auftrag gegebene Studie des Londoner Centre for Economic Policy Research (CEPR) handelt, sind die Zahlen falsch interpretiert. Bei einer sehr weitreichenden Liberalisierung erwartet das CEPR bis 2027 in der EU ein zusätzliches Wirtschaftswachstum von 0,48 Prozent – allerdings nicht jährlich, sondern insgesamt. Das entspräche einem jährlichen Effekt von gerade mal 0,03 Prozent.
„Die Wachstumseffekte sind klein und der Beschäftigungszuwachs winzig“, sagt Sabine Stephan vom IMK in der Hans-Böckler-Stiftung. Die Ökonomin hat die drei vorliegenden Studien zu den erwarteten Effekten der TTIP untersucht. Neben der des CEPR gibt es zwei Untersuchungen des Ifo-Instituts München – eine im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums, die andere im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Obwohl derartige Modellrechnungen lediglich mehr oder weniger wahrscheinliche Entwicklungen simulieren, werde der Eindruck erweckt, man hätte exakte und verlässliche Berechnungen. Wie sehr die Ergebnisse von politischen Wunschvorstellungen beeinflusst sind, verdeutlichen die Jobprognosen: Während Bertelsmann 180 000 zusätzliche Arbeitsplätze sieht, kommt das Regierungsgutachten nur auf 25 000. Der Grund: In der Studie für die Bundesregierung verrechnet das Ifo Beschäftigungsauf- und -abbau, in der Bertelsmann-Studie hingegen nicht. Doch selbst bei den 180 000 neuen Jobs der Bertelsmann-Studie handelt es sich wieder um den Gesamteffekt; der Beschäftigungsaufbau pro Jahr beläuft sich auf weniger als 13 000 neue Jobs.
In der Leitbranche Fahrzeugbau etwa könnten laut Bertelsmann 12 143 Arbeitsplätze entstehen – innerhalb von 15 Jahren. „Wir sollten zwar jeden neuen Arbeitsplatz begrüßen, doch das Risiko der TTIP ist enorm hoch“, sagt Beate Scheidt von der Abteilung Grundsatzfragen und Gesellschaftspolitik der IG Metall: „Die geringen Effekte sind das Wagnis nicht wert.“
REGRESSPFLICHT DES STAATES?
Und was ist von der geplanten Investitionsschutzklausel zu halten? Können ausländische Unternehmen künftig eine europäische Regierung etwa wegen der Einführung eines flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohns vor einem nichtöffentlichen Schiedsgericht auf Schadenersatz verklagen? Derartige Verfahren sind im Kontext anderer Freihandelsabkommen längst Realität. So fordert der französische Mischkonzern Veolia derzeit von der ägyptischen Regierung eine Kompensationszahlung von 82 Millionen Dollar wegen der Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns. Anhängig ist auch eine Forderung von Vattenfall gegen die Bundesrepublik. Wegen des Atomausstiegs will der schwedische Energieriese über eine Milliarde Euro Schadenersatz. Laut Statistik der UNO-Welthandels- und Entwicklungskonferenz UNCTAD steigt die Zahl sogenannter Investor-Staat-Klagen seit Mitte der 90er Jahre an. 2012 wurden 58 neue Klagen erhoben – ein neuer Rekord. Bislang wurden 512 solcher Verfahren bekannt. In 70 Prozent der Fälle bekam der Investor Recht.
Als Reaktion auf die Kritik hat Wettbewerbskommissar Karel de Gucht nun angekündigt, das geplante Investitionsschutzkapitel im März offenzulegen. Die Debatte dürfte damit nicht beendet sein, im Gegenteil. „Wenn die Klausel so rigoros wie beabsichtigt implementiert wird, müssen wir uns dagegenstellen“, sagt IG-Metallerin Scheidt. „Das dürfen wir nicht zulassen.“
Mehr Informationen
Präsentation der IMK-Ökonomin Sabine Stephan: http://bit.ly/1hPAbeI