 Mitarbeiter des Berliner Uniklinikums Charité fordern einen Tarifvertrag, der eine Mindestbesetzung auf den Stationen garantieren soll.
Mitarbeiter des Berliner Uniklinikums Charité fordern einen Tarifvertrag, der eine Mindestbesetzung auf den Stationen garantieren soll.
Wagnis für wenig Wachstum
Befürworter der Transatlantischen Freihandels- und Investitionspartnerschaft werfen Kritikern Panikmache vor. Doch Erfahrungen mit vergleichbaren Abkommen zeigen: Die Warnungen sind berechtigt.
Von Jörn Boewe und Johannes Schulten, Magazin Mitbestimmung 03/2014
Das Chlorhuhn bewegt. Es ist zum Wappentier der Gegner der geplanten Transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) geworden. Seit Mitte vergangenen Jahres verhandelt die EU-Kommission mit den USA über den Abschluss eines Abkommens, das Zugangsbarrieren für die jeweiligen Märkte senken, Investitionen langfristig absichern und eine Schiedsgerichtsbarkeit installieren soll, vor der Investoren ihre Ansprüche aus dem Abkommen durchsetzen können sollen. Nicht nur diese Schiedsverfahren sollen geheim ablaufen. Auch aus den laufenden Verhandlungen wurde die Öffentlichkeit bislang ausgeschlossen. Sogar Inhalte und Zielrichtung der Gespräche sowie die Zusammensetzung der Verhandlungsgruppe wurden unter Verschluss gehalten – bis es engagierten NGO-Aktivisten gelang, einige Dokumente zu „leaken“.
SKEPSIS BEIM DGB WÄCHST
Die EU-Kommission selbst hat bislang außer optimistischen Prognosen und Statements zur Beschwichtigung der öffentlichen Meinung nichts Konkretes veröffentlicht. „Die TTIP hat Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen zum Ziel“, heißt es auf ihrer Internetseite. Sie könnte „die Wirtschaft der EU um 120 Milliarden Euro“ ankurbeln und „Hunderttausende neue Arbeitsplätze kreieren“. Gelingen soll dies durch die Angleichung unterschiedlicher „Regelwerke, Normen und Zulassungsverfahren“.
Das klingt so plausibel wie harmlos nach DIN und TÜV und Blauer Engel, und fast schien es, als könne keiner etwas dagegen haben. Aber dann hielt Anfang Januar jemand das Chlorhuhn hoch: Um Salmonellen und andere Keime im Hühnchenfleisch abzutöten, dürfen US-Farmer ihr Geflügel in einer Lauge aus Chlordioxid und Natriumchlorit desinfizieren. Nach Europa dürfen die Giftcocktail-Chicken bislang nicht eingeführt werden – doch das würde sich mit der TTIP ändern. Ein Aufschrei ging durch Europa! Was die Argumente der Freihandelskritiker von Attac und NGOs nicht fertiggebracht hatten – das Chlorhuhn rüttelte die Öffentlichkeit wach.
Doch nicht nur Verbraucher- und Umweltschutzstandards kämen durch die TTIP unter Druck, befürchten die Kritiker. Auch Arbeitsschutzbestimmungen und Beschäftigtenrechte sind bedroht. Nach der Logik der Freihandelsdoktrin gelten sie letztlich als „nichttarifäre Handelsbarrieren“, die den Marktzugang erschweren oder Gewinnerwartungen schmälern können. Mitte Januar traten deshalb 60 Gewerkschafter und Intellektuelle mit einem Appell an die Öffentlichkeit, der vor einem Abbau von Arbeitnehmerrechten durch die TTIP warnte. Die Initiatoren, darunter der Publizist Werner Rügemer und der Arbeitsrechtler Wolfgang Däubler, fürchten, der Vertrag würde die Koalitionsfreiheit beschneiden und Arbeitsstandards absenken. So hätten die USA „sechs von acht Kernnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) nicht ratifiziert“, heißt es in dem Aufruf.
Ähnlich kritisch hatte sich bereits im Frühjahr vorigen Jahres der DGB geäußert. Die „Vereinheitlichung von Standards und Normen“ dürfe „nicht zulasten des Gesundheits-, Arbeits-, Verbraucher- und Umweltschutzes“ gehen, forderte der DGB. Zwar seien Wohlfahrtseffekte, die sich aus einem Handelsabkommen ergeben könnten, zu begrüßen. Gleichwohl warnte der DGB vor „übertriebenen Erwartungen“. „Wir waren damals skeptisch“, sagt Florian Moritz, Leiter des Referats Internationale und Europäische Wirtschaftspolitik beim DGB-Bundesvorstand, „und unsere Skepsis ist seitdem gewachsen.“
FRAGWÜRDIGE MODELLRECHNUNGEN
Übertrieben wird in der Tat, und zwar systematisch und mitunter erstaunlich plump. So behauptet die EU-Kommission auf ihrer Internetseite, dass „nach vollständiger Umsetzung dieses Abkommens (…) ein jährliches Wirtschaftswachstum von 0,5 Prozent BIP“ zu erwarten sei. Abgesehen davon, dass es sich bei dem „unabhängigen Bericht“, auf den sich die Kommission beruft, um eine von ihr in Auftrag gegebene Studie des Londoner Centre for Economic Policy Research (CEPR) handelt, sind die Zahlen falsch interpretiert. Bei einer sehr weitreichenden Liberalisierung erwartet das CEPR bis 2027 in der EU ein zusätzliches Wirtschaftswachstum von 0,48 Prozent – allerdings nicht jährlich, sondern insgesamt. Das entspräche einem jährlichen Effekt von gerade mal 0,03 Prozent.
„Die Wachstumseffekte sind klein und der Beschäftigungszuwachs winzig“, sagt Sabine Stephan vom IMK in der Hans-Böckler-Stiftung. Die Ökonomin hat die drei vorliegenden Studien zu den erwarteten Effekten der TTIP untersucht. Neben der des CEPR gibt es zwei Untersuchungen des Ifo-Instituts München – eine im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums, die andere im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Obwohl derartige Modellrechnungen lediglich mehr oder weniger wahrscheinliche Entwicklungen simulieren, werde der Eindruck erweckt, man hätte exakte und verlässliche Berechnungen. Wie sehr die Ergebnisse von politischen Wunschvorstellungen beeinflusst sind, verdeutlichen die Jobprognosen: Während Bertelsmann 180 000 zusätzliche Arbeitsplätze sieht, kommt das Regierungsgutachten nur auf 25 000. Der Grund: In der Studie für die Bundesregierung verrechnet das Ifo Beschäftigungsauf- und -abbau, in der Bertelsmann-Studie hingegen nicht. Doch selbst bei den 180 000 neuen Jobs der Bertelsmann-Studie handelt es sich wieder um den Gesamteffekt; der Beschäftigungsaufbau pro Jahr beläuft sich auf weniger als 13 000 neue Jobs.
In der Leitbranche Fahrzeugbau etwa könnten laut Bertelsmann 12 143 Arbeitsplätze entstehen – innerhalb von 15 Jahren. „Wir sollten zwar jeden neuen Arbeitsplatz begrüßen, doch das Risiko der TTIP ist enorm hoch“, sagt Beate Scheidt von der Abteilung Grundsatzfragen und Gesellschaftspolitik der IG Metall: „Die geringen Effekte sind das Wagnis nicht wert.“
REGRESSPFLICHT DES STAATES?
Und was ist von der geplanten Investitionsschutzklausel zu halten? Können ausländische Unternehmen künftig eine europäische Regierung etwa wegen der Einführung eines flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohns vor einem nichtöffentlichen Schiedsgericht auf Schadenersatz verklagen? Derartige Verfahren sind im Kontext anderer Freihandelsabkommen längst Realität. So fordert der französische Mischkonzern Veolia derzeit von der ägyptischen Regierung eine Kompensationszahlung von 82 Millionen Dollar wegen der Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns. Anhängig ist auch eine Forderung von Vattenfall gegen die Bundesrepublik. Wegen des Atomausstiegs will der schwedische Energieriese über eine Milliarde Euro Schadenersatz. Laut Statistik der UNO-Welthandels- und Entwicklungskonferenz UNCTAD steigt die Zahl sogenannter Investor-Staat-Klagen seit Mitte der 90er Jahre an. 2012 wurden 58 neue Klagen erhoben – ein neuer Rekord. Bislang wurden 512 solcher Verfahren bekannt. In 70 Prozent der Fälle bekam der Investor Recht.
Als Reaktion auf die Kritik hat Wettbewerbskommissar Karel de Gucht nun angekündigt, das geplante Investitionsschutzkapitel im März offenzulegen. Die Debatte dürfte damit nicht beendet sein, im Gegenteil. „Wenn die Klausel so rigoros wie beabsichtigt implementiert wird, müssen wir uns dagegenstellen“, sagt IG-Metallerin Scheidt. „Das dürfen wir nicht zulassen.“
Mehr Informationen
Präsentation der IMK-Ökonomin Sabine Stephan: http://bit.ly/1hPAbeI
Schritt für Schritt zur kollektiven Aktion
Etwa 50 eingetaktete Zulieferer machen rund um Leipzig die Handreichungen für BMW und Porsche – zum Billiger-Tarif und oft ohne Mitbestimmung und Betriebsrat. Die IG Metall trifft auf eine neue Generation von Facharbeitern, die das nicht mehr so einfach hinnehmen will.
Von Jörn Boewe und Johannes Schulten, Magazin Mitbestimmung, 03/2014
Wie Kampfdroiden aus George Lucas‘ „Krieg der Sterne“ hängen die vormontierten Auspuffanlagen dicht gedrängt und hochkant in ihren Gestellen. Neben einer Säule in der Mitte der Fabrikhalle steht ein Drucker. Er summt und spuckt ein Blatt Papier aus. René Lange steht auf einer Empore oberhalb der Halle und schaut hinunter. „Der Drucker gibt den Takt vor, nach dem sich hier alles richtet“, sagt der 29-Jährige.
»Wir sehen nur die Spitze des Eisbergs«
Umfrage bei Gewerkschaftssekretären: Knapp zwei Drittel kennen Fälle von Betriebsratsbehinderungen durch Chefs
Heiner Dribbusch arbeitet am Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung in Düsseldorf. Gemeinsam mit seinem Kollegen Martin Behrens hat er 184 Sekretäre aus DGB-Gewerkschaften zu ihren Erfahrungen mit Arbeitgebermaßnahmen gegen Betriebsräte befragt. Die Ergebnisse der Umfrage sollen am heutigen Montag vorgestellt werden. Mit Dribbusch sprach für »nd« Johannes Schulten.
neues deutschland, 10. März 2014
In letzter Zeit gab es immer wieder Berichte über Unternehmer, die gegen gewerkschaftlich aktive Beschäftigte vorgehen. Sie haben eine der ersten empirischen Studien zu dem Thema durchgeführt. Handelt es sich um einen neuen Trend oder ist die Aufmerksamkeit der Medien gestiegen?
Ich denke es ist beides. Zum einen gibt es sicherlich eine gesteigerte Aufmerksamkeit der Medien. Das hat beispielsweise mit den Auseinandersetzungen im Rahmen der ver.di-Kampagne bei Lidl um 2010 zu tun. Das Unternehmen war in die Kritik geraten, gegen Betriebsratswahlen vorzugehen. Ob es wirklich jedoch eine Zunahme von Unternehmensaktivitäten gegen aktive Gewerkschafter gibt, können wir nicht sagen. Denn es gibt keine Langzeitstudien. Von den von uns befragten 184 Gewerkschaftssekretären, kennen 59 Prozent Fälle, in denen Unternehmer versucht haben, die Gründung einer Arbeitnehmervertretung zu verhindern. Was wir sehen, ist die Spitze eines Eisberges, ohne aber sagen zu können, was noch unter dem Wasser ist.
Sie sagen, die Großzahl der Angriffe richtet sich gegen Betriebsratsgründungen. Gleichzeitig haben Betriebsräte hierzulande ein positives Image. Bernd Osterloh steht genauso für den Erfolg von VW wie das Management. Wie passt das zusammen?
Wir müssen zunächst einmal feststellen, dass es nur in neun Prozent aller Betriebe, die einen Betriebsrat wählen können, auch eine Interessenvertretung gibt. Das hat stark mit der Größe zu tun. In Großbetrieben gibt es in der Regel einen Betriebsrat, in Kleinbetrieben so gut wie nie. Widerstand seitens der Unternehmen gibt es relativ häufig im Bereich der Betriebe mit 100 bis 200 Beschäftigten. Und es verstärkt sich bei denen, die inhabergeführt sind. Hier gibt es oft die Haltung: Mitbestimmung sei zu teuer, unnötig und überhaupt eine unzulässige Einmischung.
Ist dies der alleinige Grund für die geringe Verbreitung?
In vielen Kleinbetrieben gibt es auch deshalb keinen Betriebsrat, weil weder Beschäftigte noch Gewerkschaften aktiv werden. In welchem Umfang dabei ein gewerkschaftsfeindliches Klima eine Rolle spielt, wissen wir nicht.
Zu welchen Maßnahmen greifen Unternehmer, die Mitbestimmung verhindern wollen?
Am weitesten verbreitet ist Druck auf die Kandidaten. Das kann über Drohungen und Einschüchterungen geschehen, aber auch über das Angebot von Vergünstigungen bis hin zu Geldzahlungen. Die Verhinderung der Bildung eines Wahlvorstandes ist ebenfalls nicht selten.
Haben Sie Branchenunterschiede feststellen können? Der Großteil der aus den Medien bekannten Fälle kommt aus dem Einzelhandel?
Genaue Aussagen über Branchenunterschiede können wir auf Basis unserer Daten nicht sicher treffen. Der Einzelhandel ist aber vermutlich mit oben dabei. Zum einen gibt es einige Konzerne, wie die Schwarz-Gruppe, zu der Lidl gehört, die keine Betriebsräte wollen. Dann ist die Branche sehr kleinbetrieblich geprägt. Zudem gibt es viele inhabergeführte Läden. Aber auch im Bereich der IG Metall hat es einige spektakuläre Fälle gegeben, etwa beim brandenburgischen Polarzulieferer HatiCon oder dem Trierer Elektroausrüster Natus.
In den USA wird von »Union Busting« gesprochen – also von bewussten Initiativen der Unternehmer zur Zerschlagung von Gewerkschaften. Trägt der Begriff auch für die hiesigen Verhältnisse? Es ist kaum zu erwarten, dass die IG Metall in existenzielle Nöte gerät, weil ein Unternehmer eine Betriebsratswahl verhindert.
Union Busting ist ein Begriff, der auch im gewerkschaftlichen Sprachgebrauch verwendet wird. Dabei geht es in Deutschland sicher nicht um die Zerschlagung der Gewerkschaften selbst, sehr wohl aber darum, zu verhindern, dass Gewerkschaften in bisher unorganisierten Betrieben Fuß fassen. Das ist sicher ein Motiv hinter der Verhinderung von Betriebsratswahlen. Denn generell gilt für Deutschland: Nur dort, wo es auch einen Betriebsrat gibt, verfügen Gewerkschaften über nennenswerte Präsenz.
Welche Rolle spielen sogenannte »Union Buster«, also auf die Verhinderung von Betriebsratswahlen spezialisierte Anwaltskanzleien?
Unsere eigenen Befunde deuten bislang darauf hin, dass hier möglicherweise ein Markt im Entstehen begriffen ist. Allerdings erweist sich der Marktanteil der einschlägig bekannten Kanzleien, wie die des Düsseldorfer Anwalts Helmut Naujoks, als noch sehr begrenzt. Werden Juristen hinzugezogen, handelt es sich oft um die örtlichen Hausanwälte der Arbeitgeberverbände.
Benötigen wir besseren gesetzlichen Schutz für Betriebsratswahlen?
Alle von uns festgestellten Maßnahmen gegen Betriebsratswahlen sind gesetzlich unzulässig. Es gibt aber so gut wie keine Verfahren, auch weil die Staatsanwaltschaften »mangels öffentlichem Interesse« oft einstellen. Hier wäre die Bildung von spezialisierten Schwerpunktstaatsanwaltschaften notwendig, die konsequent ermitteln. Zudem wäre zu diskutieren, die Bildung von Betriebsräten ab einer bestimmten Betriebsgröße gesetzlich zu verpflichten, wie etwa in den Niederlanden.
Perspektive mit Verfallsdatum
Air Berlin gliedert seinen Kundenservice aus und kündigt zugleich dessen Schließung an. Mitarbeiter fühlen sich »verkauft und plattgemacht«. Ver.di und Betriebsrat wollen das nicht hinnehmen.
Von Jörn Boewe, neues deutschland, 7. März 2014
Das hatte sich Air Berlin wohl anders vorgestellt: Anlässlich der Internationalen Tourismusbörse (ITB) hatte Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft zur »Air Berlin Party« am Mittwochabend im Restaurant »Zur Nolle« im S-Bahnbogen in Berlin-Mitte eingeladen. Die Party fand statt, aber wer hinein wollte, musste zuvor an etlichen aufgebrachten Call-Center-Mitarbeitern vorbei, die ihrem Ärger über die Airline lautstark Luft machten.
Zum Jahresbeginn hatte die Air Berlin ihren Kundenservice outgesourct und an eine speziell zu diesem Zweck gegründete Firma namens AuSoCon Call Center Berlin GmbH verkauft. Zugleich wurde den rund 180 Beschäftigten angekündigt, dass ihre Arbeitsverhältnisse zum Jahreswechsel 2014/15 enden sollen. Lediglich »bewährten Mitarbeitern« werde dann ein Weiterbeschäftigungsangebot gemacht werden. Wie aus einer Powerpoint-Präsentation hervorgeht, die im Unternehmen kursiert, soll dies aber mit einer Absenkung der Gehälter um 15 bis 20 Prozent verbunden sein.
AuSoCon ist ein Joint Venture: Hauptgesellschafter ist mit 80 Prozent die österreichische Firma Competence Call-Center AG (CCC), Air Berlin hält eine Minderheitsbeteiligung von 20 Prozent. Aufgerufen zu den Protesten hatte die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, unterstützt vom Betriebsrat. Nach Polizeiangaben beteiligten sich 79 Personen, etliche Beschäftigte stießen im Laufe der Aktion dazu und waren direkt von der Arbeit zur Kundgebung gekommen.
»Im Schnitt sind die Leute bei uns seit achteinhalb Jahren im Unternehmen«, sagte Betriebsratsvorsitzender Max Rack gegenüber »nd«. Bei einer entsprechend langen Betriebszugehörigkeit kämen sie auf einen Stundenlohn von 15 Euro. Berichten ehemaliger CCC-Beschäftigter in diversen Internetforen zufolge liegen die Entgelte bei dem österreichischen Betreiber etwa bei der Hälfte.
Man fühle sich »von Air Berlin verkauft«, sagte eine Servicemitarbeiterin, jetzt wolle man sich »nicht auch noch plattmachen lassen«. Offensichtlich wollen die Beschäftigten nicht tatenlos zusehen, wie ihr ehemaliger Arbeitgeber sich aus der Verantwortung stiehlt. Air Berlin habe es in der Hand, die Arbeitsplätze und Bedingungen in ihrem Service Center auch unter dem neuen Unternehmensdach »langfristig zu sichern und den Beschäftigten damit eine Perspektive zu bieten«, sagte Stefan Köchling, Sprecher der ver.di-Tarifkommission.
In der Air-Berlin-Zentrale am Saatwinkler Damm ist man offenbar der Meinung, den Mitarbeitern schon genug Perspektive geboten zu haben. Es sei der Airline »sehr wichtig« gewesen, » ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein attraktives Angebot zu unterbreiten, um auch das über Jahre erworbene Fachwissen zu erhalten«, erklärte Sprecher Mathias Radowski auf Anfrage. Die Übertragung des Kundenservice »auf einen dafür spezialisierten Dienstleister« sei »branchenüblich«, die Fluggesellschaft werde damit »kundenorientierter, schneller und effizienter«.
Zugleich stellte er klar: »Zum Jahresende wird die ASC geschlossen. Alle Mitarbeiter, die sich bewähren, sollen Angebote erhalten, in andere Gesellschaften der CCC übernommen zu werden.« Die avisierte Gehaltsabsenkung um 15 bis 20 Prozent wollte das Unternehmen auf Nachfrage nicht kommentieren.
Damit wollen sich die Beschäftigten und ihre Gewerkschaft aber nicht abfinden. »Für ihre ehemaligen Beschäftigten muss Air Berlin deutlich mehr tun«, so der zuständige Gewerkschaftssekretär Max Bitzer. Dies werde man bei den anstehenden Sozialplanverhandlungen deutlich machen. Falls sich das Unternehmen nicht bewege, werde ver.di »alle Möglichkeiten nutzen, die das deutsche Arbeitsrecht hergibt«. Tarifkommissionssprecher Köchling fügte hinzu: »Die Kundgebung war erst der Auftakt, für das, was Air Berlin noch blühen wird, wenn sie weiter auf stur schalten.«
Wie die Fluggesellschaft am Donnerstag mitteilte, konnte sie im Februar dank zusätzlicher Langstreckenflüge und Verbindungen mehr Passagiere als im Vorjahreszeitraum befördern. Die Zahl der Fluggäste stieg gegenüber Februar 2013 um zwei Prozent auf 1,84 Millionen. Weil das Unternehmen gleichzeitig sein Angebot ausweitete, blieben in den Fliegern jedoch mehr Sitze leer: Die Auslastung verschlechterte sich um 3,5 Prozentpunkte auf 81,7 Prozent. Übers Jahr will Air Berlin Flugangebot und Auslastung um drei Prozent steigen, wie Vorstandschef Wolfgang Prock-Schauer kürzlich in der Mitarbeiterzeitung ankündigte.
Der Österreicher Prock-Schauer hatte den Vorsitz der kriselnden Fluggesellschaft vor gut einem Jahr von Hartmut Mehdorn übernommen, dem es trotz ehrgeiziger Sanierungsziele nicht gelungen war, Air Berlin in die Gewinnzone zu führen. In Branchenkreisen heißt es, Prock-Schauer müsse 2014 den Turnaround schaffen oder gehen.
Reeder auf Dumpingkurs
Zahl der Schiffe unter deutscher Flagge auf historischen Tiefstand gesunken
Von Jörn Boewe, junge Welt, 4. März 2014
Anfang des Jahres hat die Zahl der zivilen Schiffe unter deutscher Flagge einen historischen Tiefstand erreicht. In der vergangenen Woche gab die für den Seeverkehr zuständige Gewerkschaft ver.di bekannt, daß die Anzahl in weniger als vier Jahren um 300 Schiffe gesunken ist. Nur noch 208 Fahrzeuge sind nach aktuellen Angaben des Bundesamtes für Seeschiffahrt und Hydrographie unter Schwarz-Rot-Gold unterwegs. Das sind nicht mal mehr sechs Prozent der über 3500 Schiffe, die von deutschem Management bewirtschaftet werden.
 |
| Ostseehafen Wismar, Sept. 2012 |
Vor gut zehn Jahren hatten Regierung, Reedereien und Gewerkschaften, moderiert vom damaligen SPD-Kanzler Gerhard Schröder, ein »Maritimes Bündnis für Beschäftigung, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit« geschlossen. Vereinbart wurde u. a., daß der Staat finanzielle Zuschüsse für Ausbildung und Lohnkosten zahlt und die Reeder im Gegenzug wieder mehr Schiffe unter deutscher Flagge fahren, nämlich zunächst mindestens 300. Später wurde das Ziel auf 600 gesteigert. Im Jahr 2008, kurz vor Ausbruch der Wirtschaftskrise, fuhren tatsächlich mehr als 500 Schiffe unter deutscher Flagge. Die Zahl der Auszubildenden in den maritimen Berufen verdoppelte sich, und mehr deutsche und EU-Seeleute fuhren an Bord deutscher Schiffe.
Inzwischen hat sich dieser Trend umgekehrt. Nach den aktuellen Arbeitsmarktzahlen der Zentralen Heuerstelle Hamburg gab es im Januar in den technisch-nautischen Berufen 18 Prozent mehr Bewerber als vor einem Jahr, während sich das Angebot an freien Stellen im gleichen Zeitraum um 16 Prozent verringerte. Zugleich ist die Zahl arbeitsloser Schiffsmechaniker binnen Jahresfrist um 31 Prozent und die der Nautiker um 26 Prozent gestiegen.
13000 bis 14000 Seeleute fahren auf deutschen Handelsschiffen, rund die Hälfte davon sind deutsche Staatsbürger. Der Anteil deutscher Schiffe an der Welthandelsflotte ist seit der Jahrtausendwende von fünf auf neun Prozent gestiegen. Doch das Maritime Bündnis hat die »Flucht aus der deutschen Flagge«, wie ver.di es nennt, nicht aufhalten können. Im Jahr 2000 waren noch 553 Anträge zur Ausflaggung von Schiffen deutscher Eigner gestellt worden, bis 2012 kletterte die Zahl auf 1819, wie aus der Antwort der vorigen Bundesregierung auf eine Anfrage der SPD vom Mai 2013 hervorgeht. Alle Anträge wurden positiv beschieden.
All das habe zu einem gravierenden Abbau von Arbeits- und Ausbildungsplätzen für deutsche und EU-Seeleute geführt, heißt es bei ver.di. Immer mehr Reeder brächten ihre Schiffe unter EU-Flaggen, die keine Besetzungs- und Bemannungsvorschriften haben. Es bestehe dahingehend »dringender Handlungsbedarf«, daß die EU ihre Leitlinien für die Seeschiffahrt konkretisiere, forderte ver.di-Bundesvorstandsmitglied Christine Behle in der vergangenen Woche. Für alle Schiffe, die in irgendeiner Form durch die EU bzw. ihre Mitgliedstaaten subventioniert werden, müßten »schnellstens« Mindestbesetzungsvorschriften mit sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen für EU-Seeleute eingeführt werden. Die Europäische Kommission müsse sich die Frage stellen, was es der EU und Deutschland nutze, wenn Schiffe in Asien gebaut, mit Seeleuten aus aller Welt besetzt werden und deutsche Reeder trotzdem finanzielle Vorteile in Form der Tonnagesteuer, Lohnkosten- und Ausbildungsbeihilfen erhielten.
Bei der »Tonnagesteuer« handelt es sich um eine in Deutschland 1999 eingeführte Methode zur pauschalen Gewinnermittlung bei Handelsschiffen. Grundlage ist die Ladekapazität der Schiffe, nicht der real erzielte Gewinn. Je nach Konjunktur schwankte die Höhe der Steuer stark. So lag sie 2004 nach Schätzungen des Finanzministeriums bei 875 Millionen Euro, stieg 2005 auf 1,115 Milliarden Euro und sank im Krisenjahr 2009 auf 40 Millionen.
Faktisch ist das ein großes Steuergeschenk an die Reeder: Bei der herkömmlichen Gewinnermittlung durch Vergleich des Betriebsvermögens am Ende des Wirtschaftsjahres hätten die Schiffahrtsunternehmen rund das Doppelte zahlen müssen. Wie eine Anfrage der Grünen im Bundestag ergab, gingen dem deutschen Staat dadurch allein von 2004 bis 2011 Einnahmen von fast fünf Milliarden Euro verloren. Mittlerweile hat sich die Tonnagesteuer weltweit als Standard durchgesetzt. Einige Staaten, darunter Griechenland, schafften die Besteuerung von Reedern ganz ab.
Neben den Steuervergünstigungen wirken die direkten Staatsbeihilfen für die Reeder im Rahmen des Maritimen Bündnisses fast schon bescheiden. Die lagen seit Bestehen des Bündnisses jährlich bei 50 bis 60 Millionen Euro.
Get organized!
Organizing war für uns das großeThema des vergangenen Jahres, aber wenn wir uns im eigenen Büro umschauen, wird schnell klar, dass wir uns selbst durchaus auch noch ein bisschen besser organisieren könnten.
Ein paar hilfreiche Tipps und Tricks dazu haben wir uns am Dienstag bei einem dju-Seminar über »Selbstvermarktung für freie Journalisten« mit Andreas Ulrich und Bernd Hubatschek abgeholt. Ulrich ist vielen Leuten in Berlin-Brandenburg vor allem als engagierter Radiojournalist bekannt. Hubatschek kennt wohl jeder, der sich in der Region als Journalist, Publizist oder Künstler selbständig gemacht hat oder machen will. Falls nicht, ist er gut beraten, ihn kennenzulernen.
Bringt so ein Grundlagenseminar Leuten, die wie wir schon ein paar Jahre im Geschäft sind, überhaupt noch etwas? Das haben wir uns vorher durchaus gefragt. Aber weil’s für Gewerkschaftsmitglieder nur lächerliche 13 Euro kostet (Essenmarke für die ver.di-Kantine inklusive), kann man eigentlich nichts falsch machen.
Vor allem macht man bei Ulrich und Hubatschek nichts falsch. Zwei alte Hasen, die sich nicht nur mit Medien- und Sozialrecht, Honorar- und Urheberrechtsfragen und sonstigen Grundlagen auskennen, sondern beide selbst einen reichen Fundus praktischer Erfahrungen haben und immer am Ball bleiben.
Die Zahlen der Verkaufsstrategen
Das seit Frühjahr 2013 zwischen EU und USA verhandelte Transatlantische Handels und Investitionsabkommen (TTIP) beunruhigt die Frankfurter Allgemeine Zeitung („In den Krallen des Chlorhuhns“, Printausgabe vom 20. Februar). Es sind aber weder der anvisierte Abbau sogenannter nicht-tarifärer Handelshemmnisse, also die Angleichung von Verbraucher- und Umweltschutzvorschriften auf niedrigstem Niveau, noch der komplette Ausschluss der Öffentlichkeit von den Verhandlungen, die der FAZ Kopfschmerzen machen. „Anlass zur Sorge bereitet, dass es der EU-Kommission immer weniger gelingt, den Bürgern die Freihandelsgespräche mit Amerika als Chance zu verkaufen“, schreibt das Blatt und zeigt gleich, wie man’s richtig macht: „Die Öffnung der Märkte könnte allein in Deutschland 100 000 neue Arbeitsplätze schaffen, jeder Haushalt hätte jährlich 550 Euro mehr zur Verfügung, erwarten Ökonomen.“
Nun ist das mit den Prognosen so eine Sache. Das Münchner Ifo Institut prophezeit in einer Studie für die Bertelsmann-Stiftung sogar 180 000 neue Jobs. In einer anderen Studie kommt dasselbe Ifo Institut – diesmal im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums – nur noch auf die deutlich bescheidenere Zahl von 25 000. Der Grund: Während in exportorientierten Branchen voraussichtlich Beschäftigung aufgebaut wird, ist in anderen Bereichen mit Arbeitsplatzverlusten zu rechnen. In der Studie für das Ministerium hat das Ifo Plus und Minus halbwegs ordentlich gegengerechnet. In der Bertelsmann-Studie war das offenbar vom Auftraggeber nicht gewünscht.
Aber auch die Kommission selbst hat’s nicht so mit ihren eigenen Zahlen. „Nach vollständiger Umsetzung dieses Abkommens“, schreiben ihre PR-Strategen, „wird ein jährliches Wirtschaftswachstum von 0,5% BIP (…) erwartet.“
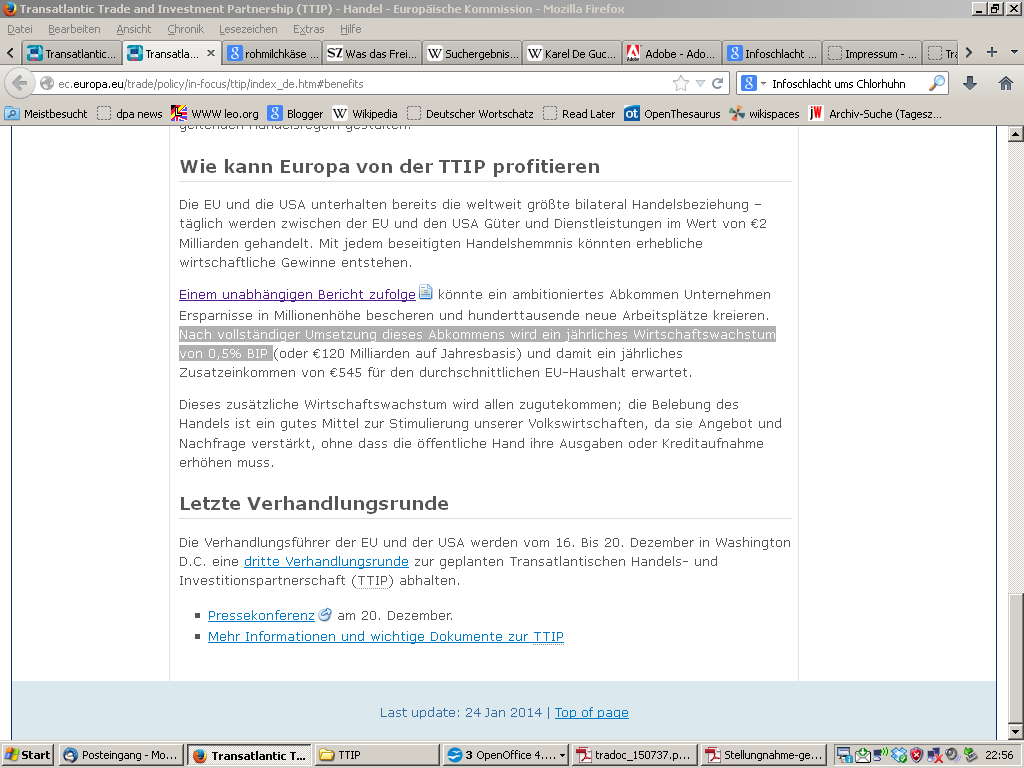 Die Zahl steht tatsächlich in einer von Brüssel in Auftrag gegebenen Studie des Londoner Centre for Economic Policy Research (CEPR). Allerdings handelt es um den prognostizierten, kumulativen Gesamteffekt nach 15 Jahren. Aufs Jahr gerechnet macht das nur 0,03 Prozent und liegt damit unterhalb der statistischen Wahrnehmbarkeitsschwelle. Mehr zu diesen Taschenspielertricks und anderen versteckten Implikationen des TTIP in einem Artikel von Boewe/Schulten in der kommenden Ausgabe des Magazins Mitbestimmung (erscheint am 15. März).
Die Zahl steht tatsächlich in einer von Brüssel in Auftrag gegebenen Studie des Londoner Centre for Economic Policy Research (CEPR). Allerdings handelt es um den prognostizierten, kumulativen Gesamteffekt nach 15 Jahren. Aufs Jahr gerechnet macht das nur 0,03 Prozent und liegt damit unterhalb der statistischen Wahrnehmbarkeitsschwelle. Mehr zu diesen Taschenspielertricks und anderen versteckten Implikationen des TTIP in einem Artikel von Boewe/Schulten in der kommenden Ausgabe des Magazins Mitbestimmung (erscheint am 15. März).»Die Demokratisierung der Wirtschaft ist überfällig«
Über Bespitzelung, Willkür und Respektlosigkeit im Einzelhandel und ein neues Buch zum »Fall Schlecker«: Ein Gespräch mit Achim Neumann und Katrin Wegener.
Johannes Schulten, junge Welt, 1. Feb. 2014
Achim Neumann (67) ist Politischer Sekretär bei der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di und betreute jahrelang die Beschäftigten der Drogeriemarktkette Schlecker
Katrin Wegener (42) hat fast 20 Jahre bei Schlecker gearbeitet. Sie war Mitglied des Gesamtbetriebsrats und dort Sprecherin des Wirtschaftsausschusses
Die Schlecker-Insolvenz hat sich gerade zum zweiten Mal gejährt. Warum veröffentlichen Sie nun ein Buch über den Fall, Herr Neumann? Sollte ver.di die Energie nicht in aktuelle Auseinandersetzungen stecken?
Achim Neumann: Sowohl als auch. Natürlich sind wir momentan in neuen Kämpfen engagiert, etwa bei Amazon. Aber der Fall Schlecker ist besonders in der Rückschau und der Aufarbeitung sehr wichtig für die gesamte Gewerkschaftsbewegung. Die Erfahrungen, die Kraft und die Solidarität, die die Frauen aus ihren Kämpfen gewonnen haben, wird uns allen bleiben, weit über den Tag hinaus. Über 27000 Beschäftigte haben durch die Insolvenz ihren Job verloren, darunter rund 25000 Filialmitarbeiterinnen. Das rechtfertigt auf jeden Fall ein Buch, wenn nicht sogar mehrere.
Sie rechnen also mit Anton Schlecker ab?
Neumann: Es ist keine Abrechnung. Uns geht es vor allem darum aufzuklären, wie in Deutschland Discounter funktionieren.
Schlecker ist also »überall«, wie es im Buch heißt …
Neumann: Schlecker hat zwar im Umgang mit Betriebsräten, Beschäftigten und der Gewerkschaft ganz besonders harsche Methoden angewendet. Doch man findet ähnliche Vorgehensweisen auch bei Aldi, Norma oder Kik. Insbesondere die Discounter sind ein Paradebeispiel für eine Branche, in der mitbestimmte und geregelte Arbeitsbeziehungen nicht gewünscht sind.
Frau Wegener, Sie haben seit 1994 bei dem Drogeriemarkt in Berlin gearbeitet. Wie sind Sie dahin gekommen, und wie haben Sie die Zeit erlebt?
Katrin Wegener: Als ich als Aushilfe angefangen habe, war ich erst mal froh, überhaupt einen Job zu haben. Ich war gelernte Unterstufenlehrerin und hatte einen Abschluß aus der DDR. Der wurde in der Bundesrepublik allerdings nicht anerkannt. Als es dann um eine volle Stelle ging, hat Schlecker versichert, wir würden nach Tarif bezahlt. Doch das war nicht der Fall. Man hat uns mit falschen Versprechungen hereingeholt, weshalb Anton Schlecker im übrigen 1998 vom Stuttgarter Landgericht wegen »vollendetem und versuchtem Betrug« verurteilt wurde.
Doch es war nicht nur die falsche Bezahlung, die uns gestört hat, es waren auch die Arbeitszeiten. Wir hatten eine Sechs-Tage-Woche, Überstunden wurden nicht bezahlt, und wenn die Mitarbeiter nicht gespurt haben, gab es Abmahnungen bis hin zu Kündigungen.
Im Buch wird insbesondere der Mißbrauch der von Anton Schlecker genutzten Gesellschaftsform des e. K., des »eingetragenen Kaufmanns« angeprangert. Ist das nicht ein Einzelfall?
Neumann: Das gibt es auch bei anderen. Dieses Konstrukt ist seinerzeit vom Gesetzgeber für klein- und mittelständische Betriebe erfunden worden. Es war nie für Großbetriebe wie Schlecker gedacht. Das Problem an der Rechtsform des e.K., ist, daß die betriebliche Mitbestimmung in wesentlichen Dingen eingeschränkt ist. So hat etwa der Wirtschaftsausschuß des Gesamtbetriebsrats keine Möglichkeit der Kontrolle der finanziellen und wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens, wie es etwa bei einer GmbH oder AG der Fall ist. Es gibt keine überprüfbare Gewinn- und Verlustrechnung. Das ist ein gravierendes Problem. Es kann nicht angehen, daß die Beschäftigten eines Betriebes einer bestimmten Größenordnung die Entscheidungen eines einsamen Kapitalisten nicht überprüfen können, wie sich diese auf den Laden und damit die Arbeitsverhältnisse auswirken. Am Ende bezahlen die Beschäftigten mit dem Verlust der finanziellen Absicherung ihrer Existenz.
Die mangelnden Kontrollmöglichkeiten beziehen sich jedoch nicht nur auf den Betriebsrat, es fehlt auch jegliche gesellschaftliche Kontrolle. Denn falsche wirtschaftliche Entscheidungen haben oft katastrophale Folgen. Schlecker war die größte Firmenpleite im Handel in der Nachkriegsgeschichte. Von den 27000 Kolleginnen und Kollegen, die ihren Job verloren haben, sind zirka 9000 bis heute nicht vermittelt. Die Folgen der Fehlentscheidungen von Anton Schlecker wurden der Gesellschaft übergeholfen. Die hatte aber keine Möglichkeit, ihn beizeiten zur Räson zu bringen. Allein die Schulden bei der Bundesanstalt für Arbeit dürften zwischen 150 und 200 Millionen Euro liegen.
Im Buch ist oft vom »System Schlecker« die Rede, was ist das?
Neumann: Anton Schlecker hat expandiert wie ein Weltmeister. Es war ein Schneeballsystem. Dabei durften sich die Hersteller der Drogeriewaren, die Lieferanten, sozusagen als Finanzierer dieser Form der Expansion betrachten. Die Erstausstattung der neuen Märkte wurde quasi zum Nulltarif geliefert. Hinzu kam, daß die Industrie lange Zahlungsziele gewährte. Obwohl die von Schlecker versprochenen 1000 Neueröffnungen pro Jahr nie wirklich umgesetzt wurden – bis 2004/2005 gab es durchschnittlich zirka 500 Neueröffnungen jährlich –, schien das für die Lieferanten dennoch, wegen der erhofften Umsatzperspektiven, attraktiv. Sie machten das Spiel mit. Die Zahl der Märkte stieg, der Umsatz wuchs. 2004 hatte Schlecker deutschlandweit 11060 Filialen mit 40400 Beschäftigten. Bis dahin funktionierte das Schneeballsystem. Schlecker hatte die Ware längst verkauft, wenn er Wochen oder Monate später die Rechnungen bezahlen mußte. In der Zwischenzeit konnte er das Geld anderweitig investieren. Das war auch einer der Gründe dafür, daß Schlecker bis zur Insolvenz keine Bankkredite aufgenommen hatte.
Wegener: Hinzu kommt, es wurden ja keine neuen Filialen gebaut, sondern alte Immobilien übernommen. Oft waren das sogar umgebaute Wohnungen, vom Trottoir nur über Treppen erreichbar. Im Osten zog Schlecker auch in die Räume der Sero, der Sekundärrohstoff-Annahmestellen, ein. Da wurden früher Altpapier oder Gläser abgegeben. Auch hier wurde natürlich praktisch nichts investiert. Im Grunde genommen hat Schlecker nur ein paar Regale reingestellt.
Neumann: Ab 2005/2006 begann das Wachstum abzunehmen, 2007 ging es gegen null. Der Schneeball begann zu schmelzen. Und ohne Wachstum wurden auch die Lieferanten vorsichtiger mit der Gewährung ihrer Rabatte und schraubten die Zahlungsfristen herunter. Das war der Anfang vom Ende.
Wie steht es um die 27000 Entlassenen? Offizielle Zahlen liegen nicht mehr vor.
Neumann: Die Bundesanstalt für Arbeit hat im März 2013 ihre Erhebungen eingestellt. Wir wissen auf Basis ihrer letzten Zahlen, aber auch aus unseren eigenen Umfragen, daß viele der Vermittelten keinen adäquaten Arbeitsplatz gefunden haben. 9000 bis 9500 Beschäftigte sind noch immer nicht vermittelt. Große Probleme hatten vor allem die Kolleginnen über 50.
Wegener: Genau. Die Beschäftigten haben nicht nur von heute auf morgen ihre bisherige Existenz verloren. Viele kamen in Jobs unter, in denen sie heute erheblich weniger verdienen. Denn bei Schlecker hat ver.di im Jahr 2000 die Tarifbindung durchgesetzt. Genauso schlimm ist, daß sie für die 20 bis 30 Jahre harte Buckelarbeit nicht einmal eine Abfindung bekommen haben.
Wer ist nun schuld an der ganzen Misere?
Neumann: In erster Linie eindeutig die Familie Schlecker durch ihre einsamen wirtschaftlichen Fehlentscheidungen. Aber auch die Politik, insbesondere die FDP-Wirtschaftsminister in drei Bundesländern. An deren Widerstand ist die Transfergesellschaft, die mit einer Bürgschaft in Höhe von 70 Millionen Euro hätte lediglich abgesichert werden sollen, gescheitert.
Sie sagten gerade, daß das Modell Schlecker bereits 2007 am Ende war. Warum hätte die Politik mit 70 Millionen Euro Bürgschaft, also öffentlichen Mitteln reingehen sollen?
Neumann: Um Jobs zu retten. Der Insolvenzverwalter war ohne Transfergesellschaft nämlich gezwungen, nach der ersten die zweite Welle der Kündigungen auszusprechen. Insgesamt wurden rund 27000 Kündigungen exekutiert. In der Folge wurden mehr als 4000 Kündigungsschutzklagen eingereicht. Die damit entstehenden finanziellen Risiken haben die Lust der Investoren zu investieren maßgeblich beeinträchtigt.
Für die Öffentlichkeit kam die Schlecker-Pleite überraschend. Sahen Betriebsrat und Wirtschaftsausschuß im Vorfeld Anzeichen für die kommende Insolvenz?
Wegener: Der Tag X kam überraschend, sogar für die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses. Wir saßen im Betriebsratsbüro und haben Anrufe von Mitarbeitern bekommen, die die Nachricht im Fernsehen gesehen hatten. Als wir, aufgescheucht und empört, in der Zentrale in Ehingen anriefen, bekamen wir keine Verbindung. Alle Telefone waren besetzt, die ganze Leitung des Unternehmens auf Tauchstation.
Mitte der 90er Jahre war die Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen (HBV) bei Schlecker kaum vertreten. Die Beschäftigten arbeiteten meist allein in einer Filiale, Kontakt untereinander gab es wenig. Zum Schluß war die Drogeriemarktkette eines der am besten organisierten Unternehmen im Einzelhandel, mußte Betriebsräte akzeptieren und den Tarifvertrag unterschreiben. Wie ist HBV und später ver.di das gelungen?
Neumann: 1995 hatten wir zirka 200 Mitglieder – bei etwa 23000 Beschäftigten. Der Ursprung dieser Erfolgsgeschichte liegt im Rhein-Neckar-Gebiet. Dort haben sich Schlecker-Beschäftigte an die HBV gewandt, weil sie nicht ihre arbeitsvertraglich zugesicherten Tarifgehälter bekamen. Das Unternehmen hatte ja behauptet, er würde nach Tarif bezahlen. Die HBV hat dann weiter recherchiert, ob es sich um Einzelfälle handelt oder auch andere Regionen betrifft. Wir haben festgestellt, daß bundesweit sehr viele Beschäftigte betrogen wurden. Und damit war es ein Politikum.
Den Kolleginnen und Kollegen war klar, daß die auch zum System Schlecker gehörenden Probleme wie Bespitzelung, Willkür und Respektlosigkeit nur mit Betriebsrat gelöst werden können. In der Folge sind dann im Rhein-Neckar-Gebiet die ersten Betriebsräte für den Filialbereich gegründet worden. Im Vorfeld kam es zu massiven Behinderungen der Wahlvorstände, Kandidatinnen wurden mit Abmahnungen überzogen oder gar gekündigt.
Wie dort gab es bei fast allen Neugründungen riesige Konflikte. Doch die zunehmende Zahl der Betriebsräte war der Schlüssel dazu, daß auch mehr Beschäftigte in die Gewerkschaft eingetreten sind. Sie haben hier ihre Interessenvertretung gesehen. Deshalb haben zuerst die Baden-Württemberger Kollegen sich entschieden, eine Kampagne zu machen. Nur reichte dafür unser »hauptamtliches« Personal nicht aus, der Betreuungsaufwand bei der kleinteiligen Filialstruktur ist enorm. Wir sind dann mit den Kirchen in Kontakt getreten, aber auch mit dem baden-württembergischen Landtag. Unter anderen war Reinhard Bütikofer von den Grünen einer der »Paten« für die Bildung von Betriebsräten bei Schlecker. Unzählige Anfragen und Anträge wurden gestellt. So kam das Thema in die Medien. In der Folge haben sich dann bundesweit Politiker aller Parteien mit den Schlecker-Beschäftigten solidarisiert. Das ist einer der Gründe für den Erfolg gewesen. Wir sind nicht alleine als Gewerkschaft vorangegangen, sondern im solidarischen Bündnis mit anderen.
Nun ist die Wahl des Betriebsrats der erste Schritt, danach ging die Drangsalierung durch Schlecker jedoch weiter …
Wegener: Ich muß sagen, daß es bei meiner Wahl in Berlin kaum zu Behinderung kam. Als es uns gab, mußten wir allerdings alles, was wir betrieblich regeln wollten und mußten, einklagen. Arbeitszeitvereinbarung? Einigungsstelle. Urlaubsvereinbarung? Einigungsstelle. Ich habe trotzdem immer erst den kommunikativen Weg versucht. Mit manchen Vorgesetzten sind wir auch gut ausgekommen, doch sind die dann immer schnell versetzt worden. Trotzdem war ich immer mit Leidenschaft Betriebsrätin. Für ein gerechtes und respektvolles Umgehen mit uns Schlecker-Frauen.
Wie kam es eigentlich zur Bezeichnung »Schlecker-Frauen«?
Wegener: Wir alle hatten eine starke Identifikation mit dem Unternehmen, aber unsere Filiale war »unsere Filiale«. Die haben wir gehegt und gepflegt, und es waren auch »unsere« Kunden. Der Begriff Schlecker-Frauen bedeutet, daß zwar jede für sich in ihrer Filiale ihren Job gemacht hat, wir aber trotzdem eine Einheit waren. Es ging doch für alle gleichermaßen um Widerstand gegen denselben Anton. Versammelt um die Betriebsräte, im Austausch auf den Betriebsversammlungen, im Gesamtbetriebsrat und in unserer Gewerkschaft. Egal wo wir uns in Deutschland befanden, wir hatten alle das gleiche Ziel: gerechte Entlohnung, gerechte Arbeitszeiten und ein würdevolles Umgehen miteinander. Dafür haben wir 16 Jahre gekämpft. Das hat uns geprägt und zu Schlecker-Frauen gemacht.
Was bedeutet das Ende der Mitgliederhochburg Schlecker organisationspolitisch für ver.di?
Neumann: Innerhalb der Teilbranche Drogeriemärkte ist uns der einzige tarifgebundene Betrieb weggebrochen. DM, Rossmann und Müller sind nicht tarifgebunden. Mehr große existieren nicht – es ist schließlich eine der am stärksten konzentrierten Teilbranchen, die es gibt. Das zweite ist, daß die Schlecker-Beschäftigten jedes Jahr für die Verbesserung der Flächentarifverträge im Einzelhandel mitgekämpft haben. Weil ihre Basis ja der Einzelhandelstarifvertrag war, haben sie sich immer stark eingebracht. Sie sind mit den anderen Kolleginnen und Kollegen auf die Straße gegangen. Es ist also nicht nur ein Verlust in der Teilbranche. Große Teile der 12000 in ver.di organisierten Beschäftigten fehlen jetzt, wenn es in den Tarifrunden des Einzelhandels auf die Straße geht. Der ver.di-Fachbereich Handel hat einen Aderlaß erlitten, bezogen auf unsere Kraft und Durchsetzungsfähigkeit. Wir konnten die Mitgliederverluste dort allerdings durch Bewegungen in anderen Teilbranchen aufgefangen. 2013 konnten wir im Fachbereich Handel einen Rekordzuwachs von 25000 Neumitgliedern verzeichnen.
Was kann man aus dem Fall Schlecker lernen? Stichwort Insolvenzen …
Neumann: Hertie, Quelle, Neckermann, Schlecker, zuletzt Praktiker und Max Bahr – die extrem hohe Zahl der Insolvenzen allein im Handel zeigt, daß offenbar die Unternehmensführung und besonders die Unternehmensentwicklung auf andere Füße gestellt werden müssen. Eine breitere Diskussion darüber, daß eine entwickelte demokratische Gesellschaft auch eine Demokratisierung der Wirtschaft, also des Kernbereichs gesellschaftlicher Macht, erfordert, ist überfällig. Es kann doch nicht angehen, daß wir eine zweigeteilte Gesellschaft haben. Die eine, die parlamentarische, ist demokratisch geordnet, die andere, die der Wirtschaft, nicht. Große Teile des Wirtschaftslebens werden zur Privatsache und für die Demokratie zur Sperrzone erklärt. Hier finden wir ausschließlich einsame Entscheidungen von autokratischen Entscheidern. Auch die Mitbestimmung nach geltendem Recht greift zu kurz. Ohne eine wirklich gleichberechtigte, paritätische Mitbestimmung der Beschäftigten in den Unternehmen bleibt die Demokratie in einer Gesellschaft unvollkommen.
Achim Neumann (Hrsg.): Der Fall Schlecker. Über Knausern, Knüppeln und Kontrollen sowie den Kampf um Respekt und Würde. Die Insider-Story. VSA-Verlag, Hamburg, 2014, 216 Seiten, 14,80 Euro
»Veritables Streikverbot«
Unter der Flagge der »Tarifeinheit« will große Koalition Grundrechte von Minderheitsgewerkschaften einschränken. Arbeitsrechtler kritisieren den Plan als verfassungswidrig
Von Jörn Boewe, junge Welt, 21. Jan. 2014
Lokführerstreiks bei der Deutschen Bahn (DB) scheinen zunächst vom Tisch. Vergangenen Donnerstag erklärte die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), daß sie ein am Mittwoch vorgelegtes Angebot der DB prüfen und bis Ende Januar auf Arbeitsniederlegungen verzichten will. GDL und Bahn verhandeln seit zwei Jahren über die Forderung nach einer finanziellen Absicherung für Lokführer, die bei Ausübung ihres Berufes ihre Lizenz verlieren.
Die Berichterstattung der letzten Wochen gab einen Vorgeschmack auf die Medienkampagne, die kommen wird, wenn die GDL-Mitglieder doch noch in den Ausstand treten sollten. »Mit skurrilen Forderungen zieht eine Gewerkschaft in den Streik«, schrieb die FAZ (12. Januar), die Lokführer würden eine »Rundumabsicherung gegen jede Unbill des Lebens« fordern, hieß es bei Spiegel online (16. Januar). Tatsächlich fordert die kleine Fahrdienstgewerkschaft »eine Absicherung bei unverschuldetem Verlust der Fahrdiensttauglichkeit beziehungsweise Lizenzverlust, beispielsweise nach Suiziden«.
Die sogenannten Spartengewerkschaften vertreten Beschäftigte, die an neuralgischen Punkten der Volkswirtschaft sitzen und deshalb schlagkräftige Arbeitskämpfe führen können. Dabei geht es vor allem um die 8800 in der Vereinigung Cockpit organisierten Verkehrspiloten, 114000 im Marburger Bund zusammengeschlossenen Klinikärzte, 10000 Stewards in der Unabhängigen Flugbegleiterorganisation UFO, 34000 organisierten Lokführer und die 3800 Mitglieder der Gewerkschaft der Flugsicherung (GdF).
Es ist nicht verwunderlich, daß einschlägige Unternehmen und ihre Verbände den Spartengewerkschaften Schwierigkeiten machen wollen. 2009 forderten Lufthansa und Deutsche Bahn erstmals öffentlich Gesetze, die die Anzahl von Streiks künftig verringern sollten. Unterstützung fanden sie bei der Deutschen Flugsicherung und verschiedenen Flughafenbetreibern. 2010 gesellte sich der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) dazu. Der DGB und die Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA) präsentierten gemeinsam einen Vorschlag, wie die sogenannte Tarifeinheit gesetzlich zu regeln sei. Anders als suggeriert, geht es dabei aber gerade nicht um das Prinzip »ein Betrieb – ein Tarifvertrag«, also die Durchsetzung einheitlicher Standards. Unterschiedliche Niveaus bei Lohn und Arbeitszeiten wie sie in zahlreichen Unternehmen üblich sind, soll es auch weiterhin geben, sofern der Tarifvertrag von der mitgliederstärksten Gewerkschaft im Unternehmen abgeschlossen wird. Insbesondere bei ver.di kam es daraufhin zu heftigen Diskussionen. Im Mai 2011 entzog der ver.di-Gewerkschaftsrat der BDA-DGB-Initiative die Unterstützung.
Jetzt will die Bundesregierung aus Union und SPD das heiße Eisen offenbar anpacken. »Um den Koalitions- und Tarifpluralismus in geordnete Bahnen zu lenken, wollen wir den Grundsatz der Tarifeinheit nach dem betriebsbezogenen Mehrheitsprinzip unter Einbindung der Spitzenorganisationen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber gesetzlich festschreiben«, heißt es im Koalitionsvertrag. »Durch flankierende Verfahrensregelungen wird verfassungsrechtlich gebotenen Belangen Rechnung getragen.«
Renommierte Arbeitsrechtler wie Wolfgang Däubler oder der frühere Vorsitzende der IG Medien, Detlef Hensche, halten die anvisierte Regelung schlicht für verfassungswidrig. »Im Kern«, schreibt Hensche in der Januarausgabe der Blätter für deutsche und internationale Politik, gehe es nicht um Tarifeinheit, sondern um ein »veritables Streikverbot«.
Alle derzeit diskutierten Vorschläge liefen auf eine »geplante Streikbeschränkung« hinaus, unterstreicht Hensche. So soll sich künftig grundsätzlich der Tarifvertrag der Mehrheitsgewerkschaft auf die Mitglieder der Minderheitsgewerkschaft erstrecken – und diese an die Friedenspflicht binden. Weil es dem bürgerlichen Recht widerspricht, an Verträge gebunden zu werden, die man nicht unterzeichnet hat, soll den Minderheitsgewerkschaften das Recht auf Teilnahme an den Tarifverhandlungen der Mehrheitsorganisationen eingeräumt werden. Ob eine solche Regelung verfassungskonform wäre, wird – so sie zustande kommt – wohl in Karlsruhe entschieden werden.
Politisch verblüfft vor allem die »Kurzsichtigkeit, die die DGB-Gewerkschaften zu einer Beteiligung bewogen hat«, wie Hensche betont. »Selbst wenn sie hoffen, eine Handvoll konkurrierender Berufsverbände mit staatlicher Hilfe aus dem Tarifgeschäft verdrängen zu können, ist keineswegs sicher, ob der Schuß nicht nach hinten losgeht.«

